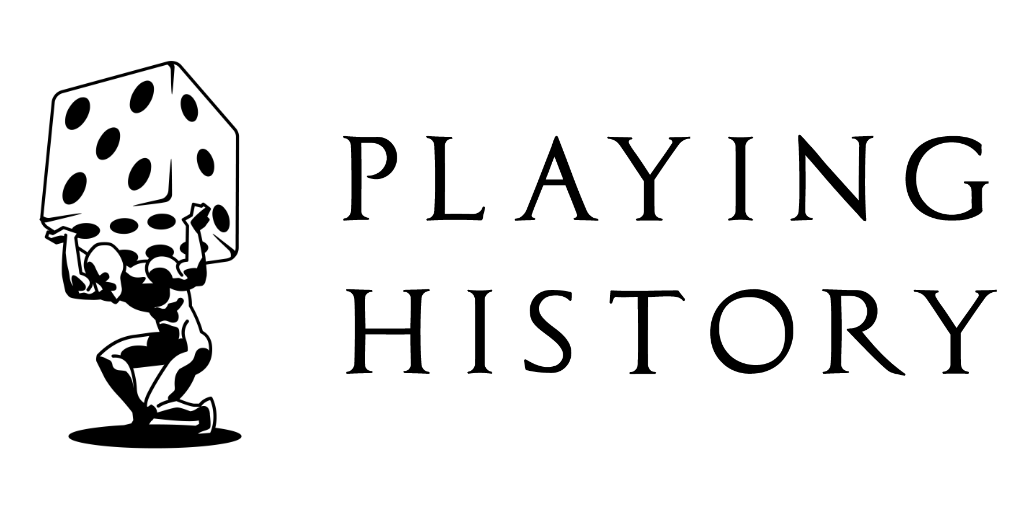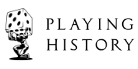Pixel und Prinzipien: Wertebildung durch Games

Mit dem Ende des Projekts “Games und Wertebildung” der Stiftung Digitale Spielekultur erscheint das Handbuch “Werte ins Spiel bringen”, das die 12 Leitfragen zum Einsatz von Games bespricht und in den wichtigen Diskurs bringt. Dr. Martin Thiele-Schwez, Geschäftsführer von Playing History, hat neben den Autor*innen Dr. Chadi Bahouth, Amir Alexander Fahim, Simoné Goldschmidt-Lechner, Jack Gutmann, Malindy Hetfeld, Dr. Karin Hutflötz, Florian Köhne, Jeanna Krömer, Hendrik Park, Hendrik Rump, Stephan Schölzel, Prof. Dr. Eik-Henning Tappe, Julian Viezens & Olaf Zimmermann den folgenden Beitrag beigesteuert.
Handbuch kostenlos downloaden
Pixel und Prinzipien: Wertebildung durch Games
Mit welcher Haltung wird ein Spiel produziert?
“Können Sie uns ein Spiel zum Thema Migration entwickeln?” Diese Anfrage erreichte mein Team und mich vor einigen Jahren und ich dachte mir, “ja, klar”. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir zu jedem Thema ein Spiel konzipieren und entwickeln können. Games bieten mehr als oberflächlichen Zeitvertreib, sie können Menschen auf vielschichtige Weise berühren und auch schwierige Themen sensibel aufarbeiten. Spätestens mit unserem Browsergame “Spuren auf Papier”, das wir mit der Gedenkstätte Wehnen entwickelten, konnten wir den Beweis antreten, dass selbst die finstersten Kapitel menschlicher Geschichte durch das Medium bearbeitet werden können. “Spuren auf Papier” widmet sich der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus und ist das erste digitale Spiel einer NS-Gedenkstätte.
Die Gretchenfrage, die sich in Zusammenhang mit sensiblen Themen stellt, ist nicht die Frage ob, sondern wie ein Thema spielerisch verarbeitet werden kann. Spiele sind – anders als lineare Medien – keine unveränderliche Äußerung. Vielmehr bilden sie ein regelgeleitetes System ab, innerhalb dessen definierte Gesetze gelten – Ursache und Wirkung. Innerhalb dieser Gesetze handeln die Spielenden und erleben eine meist individuelle Reise, die sich abhängig von ihren eigenen Entscheidungen und Handlungen gestaltet. Die große Verantwortung der Game Designer*innen liegt dabei darauf, wie die Gesetze der spielerischen Realität gestaltet sind: Was sagen sie (explizit oder implizit) aus und welches Werturteil geben sie damit über unsere Gesellschaft? Was für eine Welt zeichnen die Designer*innen?
So lernen Spieler*innen des Titels „Democracy 3“ (Positech Games, 2013) beispielsweise, dass die Todesstrafe, die sie innerhalb der spielerischen Realität einführen können, ein effektives Mittel zur Senkung der Kriminalitätsrate ist – zumindest in jener spielerischen Realität. Oder Spielende von “Die Sims” (Maxis/EA, 2000-2018) verstanden seit je, dass ein glückliches Leben insbesondere durch Karriere, mehr Geld und letztlich durch schöneres Mobiliar gewährleistet werden kann. Hinterfragt man die im Spiel dargestellten Werte, offenbaren sich absichtliche und unabsichtliche Kommentare über die Werte unserer realen Gesellschaft.
Zurück zur Migration: Aus der eingangs erwähnten Anfrage ist nichts geworden, da die notwendigen Mittel nicht eingeworben werden konnten. Hätten wir uns jedoch an dieses Unterfangen gewagt, wäre die erste Frage notwendigerweise gewesen: Was soll über Migration ausgesagt werden? Sollte das Spiel die Chancen der Migration erlebbar machen (“Deutschland benötigt nach Angaben der Wirtschaftsweisen Schnitzer jährlich 1,5 Millionen Zuwanderer, um dem Fachkräftemangel ausreichend zu begegnen.”[1] , wie es Deutschlandfunk titelte.) Oder ginge es eher darum Migration als Problemthema zu adressieren, so wie wir es aktuell in einem doch breiten Diskurs von Medien und Politik wahrnehmen (“Wir müssen endlich im großen Stil abschieben”, wie der Spiegel den Bundeskanzler Scholz zitierte.)?[2] Klar ist, dass beide (und weit mehr) Ansätze umsetzbar wären. Wenngleich die Ausrichtung natürlich eine politische Frage der eigenen Haltung darstellt. Die Aufbereitung des Themas ist jedoch sehr subtil, schließlich muss die eigene Haltung bei einer spielerischen Umsetzung nicht explizit benannt werden, sondern drückt sich eben innerhalb der Spielmechanismen aus. Wie würde ein solches Spiel “Migration” visualisieren? Wie würden die Parameter des Spiels auf meine Spielaktionen reagieren? Was wären überhaupt denkbare Spielaktionen? Und – ganz wichtig – aus welcher Rolle agiere ich überhaupt und welche Macht habe ich innerhalb des Spiels?
Die Beantwortung all dieser Fragen ist keineswegs zufällig. Sie ist begründet in den Entscheidungen der Produktion und all derer, die an derselben beteiligt sind. Umso wichtiger ist es, sowohl für die Produktion eines Spiels als auch für die Rezeption desselben genau hinzuschauen, welche Studios, Künstler*innen und Geldgeber*innen für die Resultate verantwortlich sind. Dies betrifft im Übrigen sowohl kleinere Titel, z.B. Serious Games oder Werbespiele, als auch – natürlich – AAA-Titel, also internationale Großproduktionen. Signifikante Beispiele gibt es hierzu genügend:
Denken wir an die Debatte um den Titel “Kingdom Come: Deliverance” (Warhorse Studios/Deep Silver, 2018), dessen Creative Director Daniel Vávra durch sexistische und rechtskonservative Äußerungen aufgefallen ist.[3] Dass sein Titel durch eine rein weiße, christliche, männlich dominierte Spielwelt auffällt, ist in den Augen vieler Kritiker*innen kein Zufall. Wesentlich eindeutiger ist beispielsweise ein Werbespiel eines gesichert rechtsextremistischen Vereins aus dem Jahr 2020, das als pseudo-humoriger Jump-’n’-Run-Titel versucht, rechtsextremistische Ideologien in vermeintlich zeitgemäßem Look an eine junge Zielgruppe zu tragen.
Doch selbst ohne eine gezielte Geringschätzung diverser Personen- und Gesellschaftsgruppen, kann ein Mangel an Sensibilität und/oder schlechte Beratung zur Ausgestaltung problematischer Geschichtsbilder innerhalb eines Spiels führen, wie das Serious Game “Gezeichnet – Unsere Flucht 1945” (PandaBee Studios, 2023) zeigte. Das Leipziger Studio musste sich den Vorwurf gefallen lassen, dass es in der spielerischen Aufarbeitung des Themas Vertreibung aus Ostpreußen längst widerlegte, geschichtsrevisionistische Erzählungen reproduziert.[4]
Wie können wir es also besser machen? Digitale Spiele sind hoch komplexe Medien – schließlich entstehen sie in einem langen Prozess und in der Zusammenarbeit etlicher Departments und damit in der Zusammenarbeit vieler Menschen. Diese haben unterschiedliche Weltbilder, unterschiedliche Lebenserfahrungen und sind auf der Achse “privilegiert-marginalisiert” unterschiedlich verortet. Wollen wir es als Produktionsstudio besser machen, dann sollte es der eigene Anspruch sein, zumindest hierfür ein Bewusstsein zu haben. Ist das Bewusstsein vorhanden, ist der nächste folgerichtige Schritt auf eine möglichst heterogene Zusammensetzung des Produktionsteams zu achten. Je mehr Meinungen und Lebenserfahrungen in die Produktion einfließen, desto besser gelingt es, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken. Die Initiative des game-Verbands “Hier spielt Vielfalt!” hat der Branche hier immerhin eine Selbstverpflichtung an die Hand gegeben.
Besteht der Anspruch, Spiele zu erstellen, die über das reine Entertainment hinausgehen und ein (gesellschaftspolitisches) Thema besprechen, ist es zudem unerlässlich, auch Betroffenenperspektiven einfließen zu lassen. Dies kann einerseits in Form einer expliziten Mitarbeit gelingen: Beispielsweise haben wir bei der Produktion von “Hidden Codes” – dem Mobile Game zum Thema Radikalisierung im digitalen Zeitalter der Bildungsstätte Anne Frank – großen Wert darauf gelegt, dass die involvierten Illustrator*innen selbst eine Betroffenenperspektive mitbringen und somit sprechfähig zum Thema sind. Andererseits kann auch eine Beratung durch Betroffene, Angehörige oder Zeitzeug*innen einen großen Mehrwert bieten: So wären unsere Spiele zur deutschen Teilungsgeschichte ohne das Expert*innenwissen der Zeitzeug*innen genauso wenig entstanden wie “Spuren auf Papier” ohne den kritischen Blick der Angehörigen der damaligen Opfer der NS-Morde.
Games sind ein mächtiges Medium. Nicht nur, weil sie eine riesige Zielgruppe erreichen, sondern auch, weil sie durch die Kraft von Immersion und Storytelling subtil und gleichsam kraftvoll eine Botschaft transportieren. Was und wie sie das tun, ist keinesfalls zufällig, sondern das Resultat von bewussten Entscheidungen. Mit Aufmerksamkeit und Bedacht und mit einem Zusammenschluss aus ambitionierten Game Designer*innen und der Zivilgesellschaft können wir uns diese Qualitäten zu Nutze machen und mit dem Medium, das wir lieben, für eine offene und humane Gesellschaft eintreten. Darum: Lasst uns Pixel und Prinzipien verbinden und Werte ins Spiel bringen!
……………………………………….
[1] https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaftsweise-schnitzer-netto-zuwanderung-von-400-000-menschen-pro-jahr-100.html
[2] https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-ueber-migration-es-kommen-zu-viele-a-2d86d2ac-e55a-4b8f-9766-c7060c2dc38a
[3] https://www.derstandard.de/story/2000072513959/kingdom-come-deliverance-studiochef-aeussert-sich-zu-rassismus-kritik oder vllt https://paidia.de/ist-das-mittelalter-oder-kann-das-weg-zur-debatte-um-authentizitaet-in-kingdome-come-deliverance/ oder https://www.derstandard.de/story/2000072551592/berufsspieler-kingdom-come-deliverance-rechte-ideologie-durch-die-hintertuer
[4] https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/serious-game-gezeichnet-flucht-vertreibung-heimat-eklat-foerderung-weltkrieg-100.html